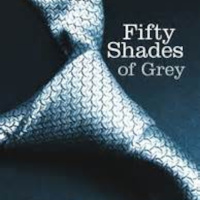Synopsis
Wir erforschen was mit Medien
Episodes
-
Elon Musks Twitterübernahme: Folgen für die Wissenschaft
25/11/2022 Duration: 43minNur 10 Prozent der Deutschen benutzen Twitter regelmäßig, dennoch schlägt die Übernahme der Plattform durch Unternehmer Elon Musk hohe Wellen. Jan-Hinrik Schmidt erklärt die Aufmerksamkeit, die dieser Unternehmensnachricht aktuell zuteilwird, so: „An Nutzer*innenzahlen gemessen mag Twitter unbedeutend erscheinen, die Plattform hat aber entscheidende Relevanz. Die Plattform verlängert publizistische Öffentlichkeit an einer wesentlichen Stelle. Es bietet Resonanzraum für Themen auf der politischen Agenda und einen Vorfeldraum, der Themen überhaupt erst auf die politische Agenda bringt.“ Twitter in der Wissenschaft Für die Wissenschaft ist Twitter ein besonders interessantes Thema. Zum einen ist die Plattform unter Forschenden ein beliebtes Tool zum Netzwerken und zur Kommunikation ihrer Arbeit, zum anderen ist Twitter auch beliebtes Forschungsobjekt, da sich über Twitter-Daten beispielsweise politische Diskurse erforschen lassen. Die Plattform bietet, im Gegensatz zu den meisten anderen sozialen Netzwerken,
-
Influencer: Ihr Erfolg bei jungen Menschen
27/10/2022 Duration: 37minWas ein „Influencer“ eigentlich ist, darüber ist die Wissenschaft noch nicht einig. Leonie Wunderlich wollte in der „Use-the-News“-Studie u.a. herausfinden, wie Jugendliche selbst den Begriff definieren „Die Perspektive von Jugendlichen und jungen Erwachsenen hat einfach gefehlt im wissenschaftlichen Diskurs über diese Personengruppe“, sagt Leonie Wunderlich. Influender, so das Ergebnis der Studie, seien in ihren Augen vor allem jene Social-Media-Persönlichkeiten, die mit Werbung ihr Geld verdienten. Vier Typen der „Social Media Content Creators” In der qualitativen Studie ging es aber nicht nur um Influencer, die nur eine Untergruppe sogenannter „Social Media Content Creators“ darstellen, die Inhalte auf Social Media zur Verfügung stellen. Auch die Angebote vieler weiterer Aktuerinnen und Akteure im Netz erfüllen bestimmte Bedürfnisse von jungen Leuten und dienen auch zur politischen Meinungsbildung. Vier verschiedene Typen von „Social Media Content Creators“ haben die Befragten genannt, bei denen mal ein
-
Journalismus und sein Publikum
08/09/2022 Duration: 40minDas Verhältnis von Journalismus zu seinem Publikum hat sich durch die digitalen Medien sehr verändert. Während Journalisten und andere Medienschaffende ihr Publikum einst noch als anonyme Blackbox wahrnahmen, in die sie hineinsendeten und aus der selten etwas zurückkam, hat das Publikum heute ein klareres Gesicht. Auf diversen Plattformen sind Journalist*innen in oft permanentem Austausch mit ihren Leser*innen, Hörer*innen oder Zuschauer*innen, die in Echtzeit kommentieren, loben oder anprangern und dadurch Einfluss nehmen auf die Berichterstattung. „Noch ist nicht ausgehandelt, was der Journalismus in dieser Beziehungspflege leisten kann, soll oder muss“, sagt der Journalismusforscher Julius Reimer. „Muss er sich mit dem Publikumsfeedback in all seiner Fülle auseinandersetzen? Muss er die Anschlusskommunikation an journalistische Beiträge mitmoderieren oder sie sogar anstoßen?“ Forschung über Journalismus-Publikums-Beziehungen Gerade deshalb sei es auch so spannend, dass die Forschung sich der Journalismu
-
Praktiken der Aneignung von Vergangenheiten
07/07/2022 Duration: 47minBarbara Christophe und Hans-Ulrich Wagner beschäftigen sich im Leibniz-Forschungsverbund „Wert der Vergangenheit“ damit, wie Menschen Bezüge zur Vergangenheit herstellen. Sie beobachten dazu den Geschichtsunterricht in der Schule, aber auch Memes und Social-Media-Projekte. „Praktiken der Aneignung von Vergangenheiten“ – hinter dieser sperrigen Formulierung steckt ein durchdachtes Konzept. Der Begriff der Aneignung lasse sich besonders gut in Bezug auf die Auseinandersetzung mit Vergangenheit anwenden, sagt Dr. habil. Barbara Christophe vom Leibniz-Institut für Bildungsmedien. „Er impliziert eine Begegnung zwischen dem Eigenen und dem Fremden. Man nimmt etwas zunächst Fremdes und passt es der eigenen Lebenswirklichkeit an. Dadurch verändert man nicht nur das Fremde, sondern natürlich auch sich selbst.“ Genau dies geschehe nämlich bei der Bezugnahme auf Vergangenheit. Ähnlich einer Reise in ein fremdes Land muss der- oder diejenige, der/die sich mit Vergangenheit auseinandersetzt, die jeweiligen Werthorizonte
-
Argument Mining
09/06/2022 Duration: 46minWas in Inhaltsanalysen einst noch mühsam händisch codiert werden musste, macht Gregor Wiedemann in einem Bruchteil der Zeit. Gemeinsam mit seinem Team entwickelt er Verfahren, die aus riesigen Textkörpern komplexe semantische Strukturen in Form von Argumenten herausfiltern. Argument Mining nennt man diese Technik. Hilfreich, wenn man in großen Textmengen, wie sie uns online begegnen, ganz bestimmte Teile herausgreifen möchte, um sie beispielsweise einer weiteren qualitativen Analyse zu unterziehen. Mit dieser Methode hat Gregor Wiedemann bereits die Debatte rund um Atomenergie in den Online-Artikeln des britischen Guardian untersucht. Aktuell extrahieren er uns sein Team Argumente aus Online-Debatten zu Mindestlohn und der Legalisierung von Marihuana. Mit fortschreitender Digitalisierung werden automatisierte Inhaltsanalysen wie das Argument Mining immer notwendiger, denn im digitalen Raum entstehen fortlaufend neue Texte. Nicht nur auf Social Media oder Online-Nachrichtenportalen: Viele Printprodukte digi
-
Mit Twitterdaten forschen
11/05/2022 Duration: 36minIn einem Auswahlverfahren, das genaue Angaben zum Forschungsvorhaben und ein Motivationsschreiben verlangte, mussten sich Philipp Kessling und seine Kolleg*innen bei Twitter um einen „akademischen Zugang“ bewerben. Einmal gewährt, erlaubt dieser das Suchen und Sammeln von Daten im Twitterarchiv, das bis ins Jahr 2006 zurückreicht. Tweetinhalte, Nutzernamen, Datum der jeweiligen Tweets, Likes und Shares können damit gesammelt werden. „Eine komplexe Datenstruktur also, mit der man ziemlich viele, ziemlich interessante Fragestellungen beantworten kann“, sagt Philipp Kessling. AfD löscht Tweets am häufigsten Zum Beispiel diese hier: Wie häufig und wann löschen Politiker*innen ihre Tweets? Dies untersuchte ein HBI-Projekt im Rahmen der Bundestagswahl 2021 und gelangte zum Ergebnis, dass ein deutlicher Anstieg der Tweet-Löschungen nach der Wahl bei fast allen Parteien zu bemerken war. Die meisten Löschungen verzeichnete die AfD. Ein weiteres Projekt hat traurige Aktualität: Seit dem russischen Einmarsch in die U
-
Vom Medienjournalismus in die Medienforschung
27/01/2022 Duration: 30min„Als Gesellschaft können wir es uns gar nicht leisten, NICHT über die Medienlandschaft zu berichten!“, sagt Anna von Garmissen. Über zwanzig Jahre lang hat sie in vielen namhaften Branchenblätter (journalist, kress, Übermedien, die Medienseiten der Süddeutschen Zeitung) den Journalismus kritisch beobachtet und weiß um die Notwendigkeit einer kritischen Begleitung von Medienleistungen. Vor allem in der aktuellen Pandemiesituation werde dies deutlich. Die Themen Transparenz und Glaubwürdigkeit etwa seien in der Vergangenheit von vielen Medienhäusern vernachlässigt worden. „Das fällt nun einigen auf die Füße. Sie müssen richtig strampeln, um dies nachzuholen.“ Diese Entwicklungen müsse der Medienjournalismus im Blick haben und ein breites Publikum daran teilhaben lassen. Wechsel in die Forschung Seit April 2021 arbeitet Anna von Garmissen als Forscherin am HBI. Ihre Wurzeln als Medienjournalistin sieht sie als Vorteil. „Ich bringe neue Aspekte mit rein, habe möglicherweise andere Herangehensweisen und natürli
-
Social Media-Nutzung der Kandidierenden zur BTW 2021
01/12/2021 Duration: 34minGanz ehrlich: Ist es nicht ein bisschen altbacken, den Einsatz von Social Media im Wahlkampf zu erforschen? Nein, sagt Jan-Hinrik Schmidt, denn Soziale Netzwerke verändern sich und damit auch die (politische) Kommunikation auf ihnen. Während beim Bundestagswahlkampf 2009 heute steinzeitlich anmutenden Plattformen wie studiVZ und oder wer-kennt-wen.de zum Einsatz kamen, setzt man nun auf Facebook, Twitter, Instagram und TikTok, auf denen die Kommunikationsgepflogenheiten gänzlich andere sind. Die kontinuierliche Beobachtung der Social Media-Nutzung zur Wahlkampfkommunikation sei wichtig, um langfristige Entwicklungen zu dokumentieren. Ergebnisse Erhoben wurde bei dieser Studie die Präsenz auf Facebook und Twitter. In künftigen Studien soll der Erhebungsrahmen auf Instagram und TikTok ausgeweitet werden. Die Ergebnisse zeigen: Zwei Drittel aller Kandidierenden zur Bundestagswahl 2021 nutzten Social Media, sie waren entweder Facebook oder Twitter vertreten. Ein Drittel der Kandidierenden nutzt ausschließlich
-
Zusammenhaltssensibler Journalismus
28/10/2021 Duration: 35minMit Expert*innen aus Journalismus, Wissenschaft, Integrationsarbeit und NGOs hat eine Forschungsgruppe des HBI die Rolle des Journalismus im gesellschaftlichen Zusammenhalt diskutiert. In vier Online-Gruppendiskussionen tauschten sich die Teilnehmenden aus über den Zusammenhang zwischen Journalismus und gesellschaftlichem Zusammenhalt und entwickelten Ideen, wie ein „zusammenhaltssensibler“ Journalismus aussehen könnte. Die Ergebnisse dieser Diskussionen bündelten Verena Albert und ihre Kolleg*innen in einem Arbeitspapier. „Die Mehrheit der Teilnehmenden hält einen starken gesellschaftlichen Zusammenhalt für einen wünschenswerten Zustand, zu dem Journalismus beitragen könne“, sagt Verena Albert. Einige Expert*innen seien aber auch der Ansicht gewesen, dass die Förderung gesellschaftlichen Zusammenhalts kein grundlegendes Ziel des Journalismus sei, sondern eher ein Nebenprodukt von “gutem”, professionellen Regeln folgendem Journalismus. Wie genau kann dies aber gelingen? In den Gru ppengesprächen haben si
-
Plattformregulierung: Von den Kleinen lernen
22/09/2021 Duration: 43minAls kleine oder mittlere Plattform gilt eine Plattform nach Christina Dinars Definition dann, wenn sie weniger als 2 Mio. registrierte Nutzer*innen im Inland verzeichnet. Sie ist somit nicht vom NetzDG erfasst, muss keinen gesetzlichen Vorgaben zur Inhaltemoderation folgen, sondern kann eigene Wege gehen. Die Content-Moderation sei auf kleineren Plattformen tendenziell communityorientierter und funktioniere (notgedrungen) oft auf ehrenamtlicher Basis, beobachtet Christina Dinar. Moderator*innen seien meist selbst ein aktiver Teil der Community dadurch würden ihre Entscheidungen über z.B. Inhaltelöschungen viel eher von der Community getragen, als jene, die von einer externen Instanz vorbenommen würden. Für Christina Dinar ist der Erfolg dieser communitybasierten (Selbst-)Regulierung keine Überraschung. Aus dem Fachbereich der Sozialen Arbeit und der Pädagogik kommend, hat sie das Konzept des „Digital Streetwork“ mitbegründet, ein Konzept, das bestehende Ansätze von Unterstützungsangeboten in eine digitale Um
-
Literatur im Radio
18/08/2021 Duration: 36minBereits kurz nach der ersten Rundfunksendung in Deutschland im Oktober 1923 begannen Schriftsteller*innen und das apparative Medium Radio aufeinander zuzugehen. Mit neuen technischen Mitteln wurde das Geschichtenerzählen für die Ohren erprobt. Das Hörspiel war geboren. Autor Alfred Döblin bezeichnete den Rundfunk gar als Rückkehr zum Ursprung des Geschichtenerzählens, der im mündlichen Erzählen liegt. Nach bescheidenen Anfängen, begann sich das Schreiben für das Radio rasch zu professionalisieren. In der nach dem Ende des Krieges unter den Alliierten neu aufgebauten dezentralen Struktur des öffentlich-rechtlichen Rundfunks entstand sogar ein regelrechter Wettbewerb untereinander, der selbstverständlichen Rolle als Kulturfaktor gerecht zu werden, berichtet Dr. Hans-Ulrich Wagner. „Man wollte gute Autor*innen gewinnen, die besten Texte für das eigene Haus erhalten. Mitunter legten kleinere Anstalten zusammen, um an das Honorarniveau der großen Anstalten heranzureichen.“ Aktuelle Herausforderungen Dr. Hans-Ul
-
Pornoplattformen und ihre Regulierung
08/07/2021 Duration: 34minUnter den meistgeklickten Websites weltweit finden sich zahlreiche Pornoseiten. Soweit, so wenig überraschend. Umso überraschender aber, dass diese so viel besuchten Seiten bei den heute oft hitzig geführten Debatten über Netzregulierung außen vor bleiben. Und das, obwohl die Gefährdungspotenziale auf diesen Plattformen groß sind: Sie reichen von dokumentiertem Kindesmissbrauch über digitale Gewalt bis hin zu nicht-einvernehmlich hochgeladenem Material. Nicht-Debatte Die Gründe für diese Nicht-Debatte seien vielschichtig, sagen Valerie Rhein und Martin Fertmann. Seit mehreren Monaten tauschen sie sich mit Forscher*innen, Journalist*innen, Aktivist*innen und Betroffenen aus, um einen besseren Überblick über diesen noch nicht gut ausgeleuchtete Themenkomplex zu gewinnen Einerseits liege es am „Schmuddel-Stigma“, das den Plattformen nach wie vor anhafte, weshalb sich Politiker*innen womöglich lieber anderen, besser vermarktbaren Themen widmen, sagt Valerie Rhein. Andererseits habe die Strukturierung von Porno
-
Nachrichtennutzung in Deutschland (Reuters Institute Digital News Report 2021)
23/06/2021 Duration: 42minAm liebsten holen sich die Deutschen ihre Nachrichten nach wie vor aus dem linearen Fernsehen. Zwar wird ihm seit geraumer Zeit der schleichende Tod vorausgesagt, doch die aktuellen Zahlen belegen, dass seine Beliebtheit in allen Altersgruppen sogar wächst. Für 44 Prozent der Befragten ist das Fernsehen die wichtigste Nachrichtenquelle, 70 Prozent nutzen mindestens einmal pro Woche TV-Nachrichten. Im Vergleich dazu haben Nachrichten in Zeitungen und Zeitschriften (26 %) sowie im Radio (40 %) 2021 in allen Altersgruppen geringere Reichweiten. Dies steht vermutlich im Zusammenhang mit den pandemiebedingten Veränderungen des Arbeitsalltags und dem Wegfallen des Arbeitswegs, welcher oft mit Radiohören im Auto oder dem Kauf einer Zeitung für Pendelfahrten verbunden ist. Nachrichten auf Social Media Außerdem sinkt die Nachrichtennutzung auf sozialen Medien. Zwar kommen insbesondere Jüngere häufig auf sozialen Medien mit Nachrichten in Kontakt (52 %), allerdings verzeichnen Nachrichten in sozialen Medien 2021 geg
-
Intermediäre in der Wissenschaftskommunikation
09/06/2021 Duration: 40minDas Science Media Center Germany (SMC) arbeitet an jener Schnittstelle, wo wissenschaftliche Expertise auf journalistische Praxis trifft. Das Büro in Köln dient als Anlaufstelle für mit wissenschaftlichen Themen befassten Journalist*innen, bereitet Themen auf und stellt Kontakte zu Expert*innen her. Mit diesem Vermittler oder „Intermediär“ entstehen neue Strukturen in der Wissenschaftskommunikation in Deutschland. Irene Broer hat im Jahr 2020 mehrere Monate in der Redaktion des SMC verbracht und den Redakteur*innen über die Schulter geschaut. Wie arbeiten sie? Wie wählen sie Themen aus? Die Ergebnisse dieser Feldforschung hat sie nun gemeinsam mit Louisa Pröschel in einem Arbeitspapier präsentiert. Das SMC erfülle mit seiner Arbeit drei Rollen: Neben der Rolle als „Knowledge-Broker“, der zwischen Wissens-Suchenden und Wissens-Schaffenden vermittelt, seien für das SMC außerdem die Rolle des „Trust-Brokers“ und des „Value-Brokers“ relevant. Als Trust-Broker arbeite es an der Herstellung und Vermittlung von s
-
Wie informieren sich junge Menschen?
28/04/2021 Duration: 36minDas gängige Vorurteil, dass Jugendliche und junge Erwachsene sich nicht für Nachrichten interessierten und nur bei ihren Lieblings-YouTubern im Netz abhängen, stimmt so nicht, sagt Leonie Wunderlich. Ihre eben veröffentlichte Studie „Use the News – Nachrichtennutzung und Nachrichtenkompetenz im digitalen Zeitalter“ liefert wissenschaftliche Belege dafür. „DIE Jugendlichen als homogene Masse gibt es einfach nicht“, erzählt sie im BredowCast. „Innerhalb der Altersgruppen der 14- bis 17-Jährigen und der 18- bis 24-Jährigen sehen wir immense Unterschiede in der Art des Nachichtenkonsums“ Die #UseTheNews-Studie identifiziert vier Typen der Nachrichtennutzung: die (1) Journalistisch Informationsorientierten, die (2) Gering Informationsorientierten, die (3) Umfassend Informationsorientierten und die (4) Nicht-journalistisch Informationsorientierten. Bezug zum eigenen Leben fehlt Die Studie hat außerdem nach der Relevanz von journalistischen Inhalten im Leben der Jungen gefragt und herausgefunden, dass vielen jun
-
Mit Memes Geschichte kommunizieren
03/03/2021 Duration: 43minMemes sind zu einer Sprache des Internets geworden. Wer sie nicht beherrscht, dem entgeht so manche Stellungnahme und Pointe. Die Medienhistoriker Dr. Hans-Ulrich Wagner und Hermann Breitenborn erklären, warum es sich lohnt, Memes kommunikationswissenschaftlich zu untersuchen, und wie über Memes Geschichte kommuniziert wird. Der Begriff „Meme“ wurde zum ersten Mal vom einem Evolutionsbiologen verwendet. Richard Dawkins schrieb 1976 in seinem Buch „The Selfish Gene“ über Memes als Merkmale, die „kulturell vererbt“ werden. Im Gegensatz zu biologischen Merkmalen, die sich über Gene innerhalb der Erblinie weiterschreiben, schreiben sich Memes über Praktiken und Nachahmung innerhalb einer Kultur fort. Seit den 1990er Jahren wird der Begriff für sich schnell verbreitende, in unterschiedlichsten Formen wiederkehrende Internet-Phänomene verwendet. Internet-Memes Noch vor zehn Jahren musste man nach Memes auf speziellen Meme-Websites (z.B. Memebase) oder auf Plattformen wie reddit oder 9gag suchen. Heute gehören si
-
Sturm aufs Kapitol, Trump und Twitter
20/01/2021 Duration: 43minDie US-amerikanische Gesellschaft ist gespalten. Die einen feiern den neu gewählten Präsidenten Joe Biden wie einen Erlöser, die anderen wollen seinen Wahlsieg nicht anerkennen. Ein Konflikt zwischen zwei Wirklichkeiten, der im Sturm auf das Kapitol am 6. Januar seinen vorläufigen Höhepunkt fand. Im US-Parlament war für diesen Tag die offizielle Auszählung der Wahlmännerstimmen im Kongress anberaumt. Diese abschließende Zertifizierung Joe Bidens als neuen US-Präsidenten wollten die Demonstrant*innen stören. Schuld nicht (nur) bei Medien Der Sturm aufs Kapitol sei ein schockierendes, aber keineswegs überraschendes Ereignis, sagt der Politikwissenschaftler Jan Rau. Die Polarisierung der US-amerikanischen Gesellschaft sei nicht von heute auf morgen passiert, sondern schwele bereits seit vielen Jahren. Den beliebten Vorwurf, die digitalen Medien seien mit ihrer Flut an Fake-News Schuld an der Polarisierung, hält er für zu kurz gefasst. Vielmehr hätte es an der Unfähigkeit konservativer Politiker*innen gelegen,
-
Wie wird man Medienrechts-Forscher*in?
09/12/2020 Duration: 36minDass aus ihm später kein schlitzohriger Anwalt würde, war Stephan schon als junger Student klar. Während seines ersten Praktikums in einer Kanzlei musste er feststellen, dass „Anwälte dazu da sind, sich zu streiten. Ich mag Streit aber nicht besonders“, sagt er. „Lieber diskutiere ich über gemeinsame Lösungen.“ Dann also Forschung. In diese rutschte er eher zufällig und zwar über das HBI. Auf der Suche nach einem Studentenjob bewarb sich Stephan zunächst für eine Stelle des IT-Admin. Damals in den Neunzigern, brannte er für alles, was mit Computern und dem Internet zu tun hatte, und programmierte bereits selbstständig Websites. Als HBI-Direktor Wolfgang Schulz beim Bewerbungsgespräch überrascht feststellte, dass Stephan Jura studierte, stellte er ihn kurzerhand als rechtswissenschaftliche Hilfskraft ein. Diese Arbeit machte ihm so viel Freude, dass er fortan immer weniger Zeit den Hörsälen der rechtswissenschaftlichen Fakultät und immer mehr im HBI verbrachte. Gute Leute im Medienrecht gefragt Der Weg in d
-
Regulierung von Telegram und Zoom
25/11/2020 Duration: 47minSpätestens seit Corona kennen wir die Plattformen Zoom und Telegram etwas besser. Hier die unersetzliche Komponente im Home-Office, dort die vermeintliche Spielwiese der Corona-Leugner*innen, auf der prominente Stimmen wie Attila Hildmann und Xavier Naidoo hunderttausende Menschen erreichen. Telegram Nicht nur bei Menschen mit sogenannten „alternativen Meinungen“ ist Telegram beliebt, sondern auch bei jenen, die illegale Inhalte verbreiten wollen. Einer Studie der Landesanstalt für Medien NRW zufolge, finden sich Telegram Rechtsverstöße in den Bereichen Rechtsextremismus, Pornografie, Drogen- und Dokumentenhandel. Der Ruf nach einer Regulierung dieser digitalen Räume wird immer lauter. Zoom Auch bei Zoom stellt sich die Frage nach Regulierung. Durch seine wachsende Bedeutung als Kommunikationsraum wachsen auch Begehrlichkeiten, Vorgaben darüber zu machen, was auf der Plattform gesagt werden darf und was nicht. Zum Teil geschieht dies bereits. Eine Vortragsveranstaltung mit der zur Palästinenser-Organisati
-
Europäische Medienkonferenz
20/11/2020 Duration: 35minVier Monate lang, von Juli bis Oktober 2020, hat unser Institut die EU-Medienkonferenz wissenschaftlich begleitet. Die Konferenzserie fand im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft statt. Ziel war die Diskussion über einen für alle Mitgliedstaaten einheitlichen gesetzlichen Rahmen für die europäische Medienlandschaft. Wolfgang Schulz und Amélie Heldt erzählen im Detail, worüber während der Konferenz diskutiert wurde, zu welchen Ergebnissen man kam und welche Akzente das HBI bei der wissenschaftlichen Begleitung gesetzt hat. Zusammenspiel von Wissenschaft und Politik Als Wissenschaftler die Politik zu beraten sei nicht immer einfach, sagt Wolfgang Schulz. „Herausfordernd sind schon die unterschiedlichen Zeithorizonte. Politik verändert sich in nur sehr kleinen Schritten.“ Außerdem sei man beim wissenschaftlichen Beraten von Politiker*innen immer mit einem „Power Play“ konfrontiert. „Es gibt wohl kein generelles Interesse aller Akteure daran, dass sich die Medienregulierung kohärent und auf Fakten basi